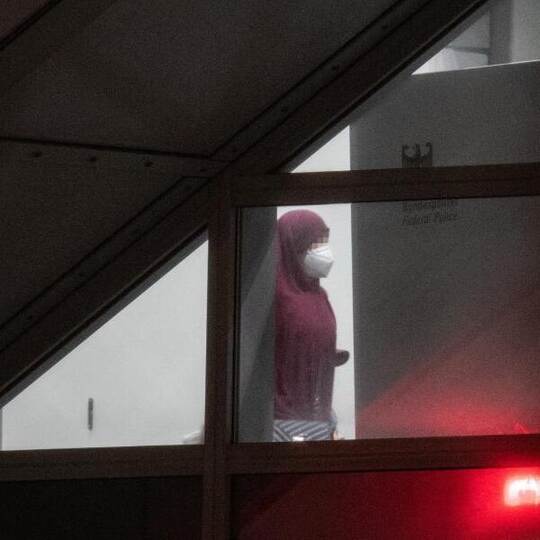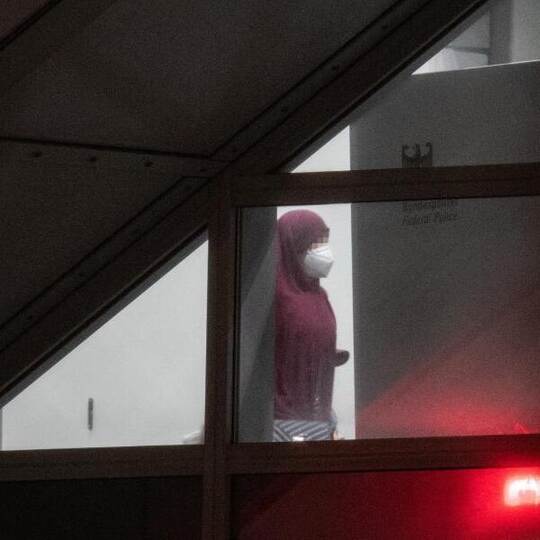Das sitzt: Professorin Susanne Schröter, Leiterin des „Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam“, wirft der Bundesregierung Versagen im Kampf gegen den Islamismus und Frauenfeindlichkeit vor. Sie spricht von Peinlichkeiten der Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und von Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) im Umgang mit islamischen Staaten und von einer Politik des Wegsehens.
Sie fordert, dem politischen Islam Einhalt zu gebieten. Mit diesen Themen beschäftigt sie sich auch in ihrem neuen Buch „Der Kulturkampf. Wie eine neue woke Linke Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft bedroht“. Am Montag, 22. Juli, ist Schröter im PZ-Forum zu Gast.
Pforzheimer Zeitung: Sie werfen der Bundesregierung mangelnde Geradlinigkeit und eine Doppelmoral bei den Menschenrechten in der Innen-und Außenpolitik vor. Was muss konkret und sofort anders werden?
Susanne Schröter: Die Politik sollte allzu starke Abweichungen zwischen politischer Rhetorik und praktischem Handeln vermeiden. Wenn unsere Bundesinnenministerin mit einer One-Love-Armbinde in Katar erscheint, der Vizekanzer sich aber gleichzeitig unterwürfig beim Emir um eine Energiepartnerschaft bemüht, dann wirkt dies peinlich. Wer bekundet, die Energieversorgung vorrangig durch Verträge mit Demokratien garantieren zu wollen, sollte weder die Golfstaaten noch Aserbaidschan meinen. Diese Art von Symbolpolitik hat keinen Sinn und macht auch keinen guten Eindruck.
Was kann die Politik in Europa dann tun?
Europa kann sicherlich nicht die Innenpolitik Katars beeinflussen und dort die Rechte von Frauen und sexuellen Minderheiten verbessern, aber sie kann Katar daran hindern, Einfluss in europäischen Ländern auszuüben. Das geschieht aber nicht. Ähnliches gilt auch für Länder wie den Iran. In Hamburg befindet sich die Europa-Zentrale des iranischen Regimes, doch Forderungen, dieses zu schließen, blieben bislang ungehört.

Mit welchen Folgen?
Der politische Islam, der für die Entrechtung von Frauen, Schwulen und Lesben steht, existiert nicht nur in Asien und Afrika, sondern auch in Europa und in Deutschland, also dort, wo wir legitime Handlungsoptionen haben. Getan wird allerdings nichts. Islamisten marschierten vor einigen Monaten streng geschlechtergetrennt durch die Straßen von Essen und Hamburg und forderten ungehindert ein Kalifat, in dem Frauen natürlich massiv diskriminiert würden. An Schulen geraten muslimische Mädchen unter Druck, wenn sie islamistische Spielregeln nicht beherzigen und sich beispielsweise nicht verschleiern. In Moscheen wird Frauenfeindlichkeit als religiöse Doktrin gepredigt. Die Reaktion der Politik besteht weitgehend aus einem Wegsehen. Schlimmer noch ist, diejenigen, die solche Themen ansprechen, werden häufig als islamfeindlichoder gar als „antimuslimische Rassisten“ denunziert.
Thema Iran: Sie sagen, wenn das Kopftuch fällt, dann fällt die Islamische Republik Iran. Ist nach der Wahl des neuen als gemäßigt geltenden Präsidenten Massoud Peseschkian am 6. Juli eine Art Trendwende in Sicht?
Davon ist nicht auszugehen. Peseschkian hat zwar das harte Vorgehen des Regimes gegen die aufständischen Frauen kritisiert, gleichzeitig aber stets seine Loyalität zu Ayatollah Chamenei, dem Obersten Führer der Islamischen Republik, erklärt. Dieser hat das eigentliche Sagen im Iran, nicht der Präsident. Dass der Kopftuchzwang aufgehoben wird, ist ebenso unwahrscheinlich wie eine Entwicklung, an deren Ende die rechtliche Gleichstellung von Frauen und Männern steht. Änderungen könnte es allerdings im Verhältnis zu Europa geben. Peseschkian möchte wieder über das Atomabkommen und ein Ende der Sanktionen sprechen, unter denen das Land leidet. Gleichzeitig hat er keinen Zweifel an den guten Beziehungen zu Russland und China gelassen. Der Iran ist sowohl Mitglied des BRICS-Verbundes als auch der Schanghai-Kooperation.


Islamforscherin: Beunruhigende Allianzen bei Antisemitismus
Hamas wird verherrlicht, Israel dämonisiert, lautet eine Ihrer Thesen. Der ehemalige israelische Botschafter Avi Primor hat kürzlich im PZ-Autorenforum erklärt, dass nur ein Rückzug Israels aus dem Westjordanland dauerhaft Frieden bringen könne. Stimmt das?
Der Historiker Michael Wolffsohn hat ein Föderationsmodell vorgeschlagen. Es gibt verschiedene Ideen, die allerdings gegenwärtig nicht realistisch sind, weil nicht nur radikale Siedler dem im Wege stehen, sondern vor allem die Hamas und eine sehr weit verbreitete Einstellung unter der palästinensischen Bevölkerung, dass Israel als Staat ausgelöscht werden solle. Dafür steht ja die Parole „From the river to the Sea“.
Der französische Schriftsteller Michel Houllebecq beschreibt in seinem Roman „Unterwerfung“ wie ein europäischer Staat zwar subtil, aber gezielt, islamisiert wird. Ist das ein drohendes Szenario?
Wenn man sich anschaut, dass Islamisten tatsächlich darüber sprechen, den Westen zu unterwandern und zu destabilisieren, fühlt man sich selbstverständlich an Houllebecq erinnert. Aber ein Roman ist natürlich kein Drehbuch für die politische Wirklichkeit. Man sollte die Vertreter des politischen Islam als antidemokratische Akteure verstehen, die dezidierte Zukunftsvisionen haben und diese langfristig umzusetzen versuchen. Dazu gehört nicht zuletzt die Abwehr von Kritik. Sie sind bislang ziemlich erfolgreich gewesen. Ein Beispiel: Im vergangenen Jahr wurde ein Bericht zur angeblichen Muslimfeindlichkeit vom Bundesinnenministerium herausgegeben, der jedwede Kritik am Islamismus, an Gewalt im Namen der Ehre und an Clankriminalität unter den Verdacht der Islamophobie stellte und einen haarsträubenden Maßnahmenkatalog vorlegte, der einem islamistischen Unterwanderungshandbuch entsprungen sein könnte. Aufgrund rechtlicher Einsprüche wurde der Bericht wieder von der Homepage des Ministeriums genommen. Ich versuche, über den politischen Islam aufzuklären, und hoffe, dass man ihm Einhalt gebieten kann.


Schröter: Palmer-Eklat hat die Wissenschaft beschädigt
Ist die Religion die Wurzel allen Übels in der Welt oder kann sie auch befrieden?
Religiöse Praxis basiert auf den Interpretationen religiöser Texte durch Theologen. Diese kann man ebenso friedlich wie unfriedlich deuten. Der Islam hat gegenüber dem Christentum jedoch das Problem, das er als das wortwörtliche Wort Gottes gilt, was allzu „freihändige“ Interpretationen schwierig macht. Die historische Kontextualisierung und die Hermeneutik, die in der christlichen Theologie längst akzeptiert werden, gilt den meisten muslimischen Theologen immer noch als Häresie. Deshalb haben es reformorientierte muslimische Theologen wie Abdel-Hakim Ourghi, der sich auch mit dem Gewaltpotential des Islam befasst, extrem schwer.
Dazu nachgehakt: Ist ein möglicher Weg aus Kriegen, Krisen und Unterdrückungen ein Interreligiöser Dialog?
Interreligiöser Dialog ist dann wirkmächtig, wenn heikle Dinge angesprochen und in Folge vielleicht sogar Probleme angegangen werden. Solange man diese sorgfältig ausspart und stattdessen ausschließlich nette Gemeinsamkeiten betont, bleibt der Effekt sehr begrenzt.


Kulturelle Aneignung: Wertschätzung oder Ausbeutung?
Entsetzt es Sie, wenn Sie bisweilen von weit Rechts Beifall erhalten?
Ich ärgere mich immer, wenn meine Aussagen verkürzt, falsch dargestellt oder aus dem Zusammenhang gerissen werden. Das geschieht allerdings nicht nur von rechten, sondern auch von linken Akteuren. Faktisch werde ich dies allerdings nicht verhindern können. Alles, was publiziert wird, kann auch missbraucht werden.
Was gibt Ihnen, trotz einer Gewalt- und Hass-Spirale, noch Hoffnung?
Ich glaube nach wie vor an die Macht der Aufklärung und daran, dass Menschen tendenziell etwas Gutes für sich und andere wollen. Das ist nicht immer einfach umzusetzen, aber wir sind ja glücklicherweise mit der Kraft der Vernunft ausgestattet, die uns ein guter Kompass beim Navigieren in unsicheren Gewässern sein kann.
Im PZ-Forum ist Susanne Schröter am Montag, 22. Juli, um 19 Uhr mit ihrem Buch „Der Kulturkampf. Wie eine neue woke Linke Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft bedroht“ zu einem Vortragsabend zu Gast. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung bei der „Pforzheimer Zeitung“ ist unter (0 72 31) 93 31 25 erforderlich.