Der Journalist Hasnain Kazim spricht im PZ-Interview über deutsche Kultur, Dinge, die uns spalten – und Dinge, die uns zusammenhalten.
Deutschland steht vor einer richtungsweisenden Wahl. Und schon bevor es am 23. Februar an die Wahlurne geht, beschäftigen die Deutschen die ganz großen Fragen. Welche das sind, hat der Journalist und Autor Hasnain Kazim sich mal persönlich angehört. Er ist mit dem Fahrrad quer durch die Republik geradelt – und hat aus seinen Erfahrungen einen politischen Reisebericht verfasst. Mit „Deutschlandtour – Auf der Suche nach dem, was unser Land zusammenhält“ kommt er am Mittwoch, 19. Februar, ins PZ-Autorenforum und erzählt, was ein gutes Miteinander in diesen Zeiten ausmacht.
PZ: Leben wir wirklich in einem gespaltenen Land – oder ist das etwas, das Journalisten gerne schreiben?
Hasnain Kazim: Eine gewisse Spaltung ist da. Man könnte den Eindruck haben, es bestünde alles nur noch aus Konflikt und Krise und Streit. Das ist natürlich nicht so. Aber dieses Nicht-mehr-miteinander-reden und Nicht-mehr-vernünftig-miteinander-streiten-können – das nimmt schon zu.
Es fühlt sich vor der Wahl schon an, als wären diese Gräben zu tief, um sie zu überwinden.
Grundsätzlich sind Gräben gar nicht schlimm. Das ist ja der Vorwurf, der immer seitens der Populisten kommt, dass die sogenannten Altparteien alle einer Meinung wären. Das kann man vielleicht sogar so sehen, weil man versucht hat, sich gegen die Populisten zusammenzutun. Tatsächlich wird innerhalb des demokratischen Spektrums hart gerungen und gestritten, man sieht es ja auch in diesen Tagen. Und das ist in Ordnung so. Viele Unterschiede, die unüberwindbar erscheinen, sind tatsächlich überwindbar, wenn wir ein friedliches, vernünftiges, zivilisiertes Miteinander wollen. Wenn man das nicht will, wird es nie gelingen. Aber wenn doch, kann man auch die tiefsten Gräben zuschütten oder Brücken bauen.


"Wir sind vollkommen enttäuscht": Pforzheimer Schüler haben gefragt, Politiker geantwortet
Sie selbst sind in Norddeutschland groß geworden, quer durch Deutschland geradelt und wohnen aktuell in Wien. Wie unterschiedlich sind die Menschen, obwohl wir ja eigentlich alle dieselbe Sprache sprechen?
Die deutsche Sprache ist wunderbar – sie ist meine Heimat. Aber sie ist gar nicht so identisch überall. Das Niederdeutsche – also Plattdeutsch – ist nicht mal ein Dialekt, sondern eine eigene Sprache. Und wenn ich im Bayerischen Wald bin, brauche ich einen Dolmetscher. Es gibt natürlich regionale Unterschiede – das ist aber klischeebehaftet, wenn man über die fröhlichen Rheinländer und die wortkargen Norddeutschen spricht.
Haben sich diese Klischees auf Ihrer Reise denn bestätigt?
In Vorurteilen steckt natürlich immer ein wahrer Kern. Den Eindruck hatte ich schon, dass es ein bisschen dauert, bis die Leute auftauen, wenn man in Norddeutschland unterwegs ist. Und dass man im Rheinland sofort eingeladen wird, sich an den Tisch zu setzen, und direkt ein Glas Wein hingestellt bekommt. Die Bayern sind eben die Bayern. Das macht ja auch Vielfalt aus. Aber das sind nicht die Gräben, die uns spalten.
Die sind auf politischer Ebene?
Ein großes Thema ist Migration. Es geht aber auch um den Klimaschutz, um Wirtschaft und Wohlstand. Es gibt sehr unterschiedliche Auffassungen, wie man mit all diesen Dingen umgehen soll. Das ist ja auch in Ordnung. Demokratie und gesellschaftliches Miteinander bedeuten kontinuierlichen Wandel, kontinuierliches Aushandeln von Dingen.
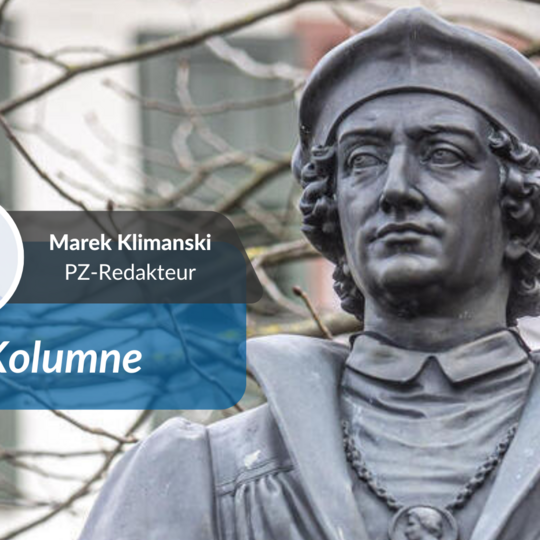
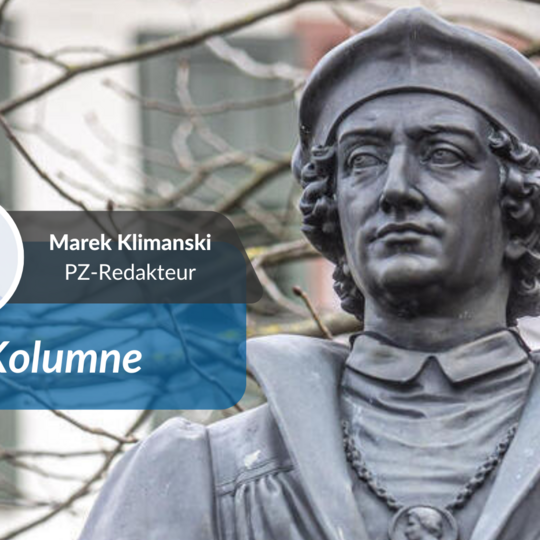
Nach Merz-Vorschlägen: Reuchlin ergreift in der Asyldebatte das Wort
Wir haben von Unterschieden gesprochen. Gibt es etwas, was uns alle zusammenhält?
Natürlich! Sicherlich auch unsere Sprache. So unterschiedlich sie ist, ist es aber schon etwas, was uns zusammenhält. Ich würde jedem raten, der in Spanien lebt, Spanisch zu können. Und ich finde es auch kritikwürdig, dass Deutsche, die in Thailand leben, kein Thai können. Die Sprache eines Landes zu können ist etwas ganz Wichtiges. Natürlich hält uns unsere gemeinsame Kultur zusammen, die ja auch sehr vielfältig ist. Unsere Literatur, unsere Musik, bildende Kunst, darstellende Kunst. Unsere gemeinsame Geschichte, auch die dunklen Teile. Wenn man durch Deutschland radelt, kommt man eigentlich in jedem Ort in irgendeiner Form an Gedenken der Gefallenen und Toten der beiden Weltkriege vorbei. Religion spielt natürlich eine Rolle. Es stimmt, dass das Christentum Deutschland geprägt hat, auch wenn die Kirchen jetzt immer weniger eine Rolle spielen.
Sind Geschichte und Religion nicht Dinge, die Zuwanderer und Menschen mit Migrationsgeschichte oftmals schon von vornherein ausschließen?
Es schließt sie nicht aus, aber es verlangt ihnen sehr viel ab. Ich persönlich finde es falsch, wenn man sagt, jemand kommt hierher und lebt genau so weiter, wie er es vorher im Herkunftsland gemacht hat. Man muss hier schon gestalten und sagen: Das sind unsere Werte, das sind unsere Grenzen. Das verlangt Menschen ab, dass sie die Sprache lernen, dass sie sich auseinandersetzen mit der Art der Dinge hier. Dafür bringen sie natürlich auch etwas mit. Ihre Kultur, ihre Küche, bestimmte Ansichten, die sich unterscheiden. Das ist wieder ein schwieriger Prozess, aber irgendwie auch ein guter, dass man permanent miteinander im Gespräch stehen und aushandeln muss: Wie gestalten wir unsere Gesellschaft?
Sie haben gerade schon über die Menschen gesprochen, die Sie auf Ihrer Reise getroffen haben. Beschäftigen diese Leute die gleichen Dinge wie die Politik?
Der Vorwurf ist, dass in Politik und Medien ganz oft Themen behandelt werden, die an der Lebensrealität der Leute vorbeigehen. Das kann man jetzt so oder so bewerten, aber ich nehme einfach zur Kenntnis, dass viele Leute das so sehen. Ein Thema war das Gendern. Das scheint die Leute massiv aufzuregen. Viele Politiker behandeln das aber so, als wäre das sehr wichtig und merken gar nicht, wie viele Leute sie damit vor den Kopf stoßen.


Ist Populismus im Design erlaubt? Hochschulprofessor über Trends bei Wahlplakaten
Die Parteien, die sich als besonders bürgernah geben, sind gerade die extremen.
Das ist der Punkt. Was ich eben tatsächlich im Osten schon sehr oft gehört habe, ist die Aussage, dass die AfD-Politiker noch vor Ort sind. Die kommen auch jenseits von Wahlkampfzeiten, die sind in den Vereinen Mitglied, die hören einem zu, die nehmen einen ernst, die reden auf Augenhöhe, während das andere nicht tun.
Ich glaube, was ganz viel mit diesem Gefühl des Nichtgehörtwerdens zu tun hat, ist, dass viele Politiker aus demokratischen Parteien Dinge auf gar keinen Fall sagen, weil sie Angst haben, dass sie sonst Zustimmung von der AfD bekommen. Man will auf gar keinen Fall im selben Eck stehen. Oder man macht das Gegenteil. Man rennt den Rechten geradezu hinterher oder versucht, sie noch rechts zu überholen. Auch das ist absurd.
Meinen Sie also, dass die Brandmauer schädlich ist?
Die Brandmauer hilft zumindest nicht, das Erstarken der AfD einzudämmen. Sie führt eher dazu, dass viele Wähler der AfD das Gefühl haben, sie würden ausgegrenzt werden und die Brandmauer richte sich gegen sie. Die Brandmauer ist das eine, der Schutz vor Extremismus das andere. Viel wichtiger ist doch die Frage: Wie löschen wir den Brand jenseits der Brandmauer? Dann brauchen wir diese nämlich gar nicht mehr.
Zum Schluss noch eine leichte Frage: Currywurst? Maultaschen? Oder doch Grünkohl?
Alles drei! Weil alles drei zu Deutschland gehört und sehr unterschiedlich ist. Mit Grünkohl kann man in Baden-Württemberg jetzt nicht so punkten. Ich hatte mal meine schwäbischen Kolleginnen und Kollegen zum Grünkohlessen eingeladen. Das waren zwei sehr stille Stunden. Ich mag Currywurst. Maultaschen finde ich auch fantastisch. Und dann gibt es noch etwas, was Sie nicht erwähnt haben: den Döner. Der Döner ist eine Erfindung von Menschen mit türkischen Wurzeln, in Deutschland. In Heilbronn gibt es zum Beispiel den Streit, ob es zu viele Dönerläden gibt. Aber nicht der Döner, sondern die Monokultur ist das Problem. Ich fände einen Ort, wo es nur Schnitzel-Restaurants oder nur Currywurstbuden gibt, auch blöd. Es ist toll, wenn Dinge sich weiterentwickeln und Neues dazukommt.

Zur Person
Hasnain Kazim wurde 1974 als Sohn indisch-pakistanischer Einwanderer in Oldenburg (Niedersachsen) geboren und ist im Alten Land bei Hamburg aufgewachsen. Er studierte Politikwissenschaften und arbeitete als Journalist unter anderen für den „Spiegel“ und „Spiegel Online“. Er lebt und arbeitet aktuell als freier Autor in Wien.
Für seine Arbeit wurde er mit diversen Preisen ausgezeichnet, darunter dem „CNN Journalist Award“. Kazim engagiert sich gegen Rassismus und Populismus und behandelt häufig gesellschaftliche Themen und den interkulturellen Dialog.
Am Mittwoch, 19. Februar, ist Hasnain Kazim im PZ-Autorenforum zu Gast und stellt sein Buch „Deutschlandtour – Auf der Suche nach dem, was unser Land zusammenhält“ vor. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr. Karten für 10,50 Euro (mit PZ-Abocard für 6,50 Euro) gibt es telefonisch unter (0 72 31) 9 33-1 25 oder online auf www.pz-forum.de

