Wer ein Speichersystem zur Photovoltaikanlage hat, kann Teile des selbst erzeugten Sonnenstroms auch nachts verbrauchen. Doch bei den Speicherkapazitäten gilt: größer ist nicht immer besser.
Ein Stromspeicher kann eine sinnvolle Ergänzung zu einer Photovoltaikanlage sein. Mit einem solchen Speicher lässt sich der Anteil des selbst erzeugten Stroms, der für den eigenen Verbrauch genutzt werden kann, merklich steigern. Darauf weist die Verbraucherzentrale in ihrem Faktencheck „Die richtige Speichergröße“ hin.
Der Batteriespeicher kann überschüssigen Strom, der am Tag auf dem Dach erzeugt wurde, aufnehmen. Besteht nachts oder in der Dämmerung mehr Strombedarf als die PV-Anlage liefern kann, lässt sich der auf dem Dach erzeugte Strom durch das Entladen des Speichers zeitversetzt nutzen.
Faustregel für Speicherkapazität
Zu groß sollten Stromspeicher in Privathaushalten aber nicht ausgelegt werden, so die Verbraucherschützer. Demnach kann man sich an folgender Faustregel orientieren: ca. 1 kWh Speicherkapazität je 1000 kWh Haushaltsstromverbrauch. Speicher, die deutlich größer sind, könnten hingegen nur noch schlecht ausgelastet werden und brächten somit kaum Zusatznutzen.
Günstiger als eine größere Speicherkapazität sei immer die Verschiebung des Stromverbrauchs in Zeiten mit ausreichend Solarertrag. Spülmaschine, Waschmaschine und Trockner lassen sich etwa gut per Zeit- oder Fernsteuerung oder mithilfe eines Energiemanagementsystems in entsprechenden Zeitfenstern nutzen. Der dann selbst verbrauchte Strom sei laut Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz deutlich günstiger als der in einer Batterie zwischengespeicherte Strom.


Und was, wenn man eine Wärmepumpe hat?
Haushalte, die mit Wärmepumpen heizen, haben zwar einen deutlich höheren Stromverbrauch, so die Verbraucherzentrale-Rheinland-Pfalz. Trotzdem sei es nicht ratsam, einen Stromspeicher deshalb wesentlich größer auszulegen. Die zusätzliche Speicherkapazität könnte kaum genutzt werden, da im Winter, wenn die Wärmepumpe viel Strom benötigt, kaum Solarstrom für deren Versorgung übrig sei.
Der geringe Überschuss könne dann auch thermisch gespeichert werden, indem die Raumtemperatur angehoben wird, wenn der Strom zur Verfügung steht. Für die Warmwasserversorgung im Sommer könne die Wärmepumpe zudem so eingestellt werden, dass sie tagsüber den Warmwasserspeicher aufheizt und den zur Verfügung stehenden Solarstrom so direkt verbraucht, ohne das eine Zwischenspeicherung nötig ist. Demnach sei also nur in den Übergangszeiten mit einem gewissen Zusatznutzen zusätzlicher Speicherkapazität zu rechnen. dpa
Druck zum Umstieg steigt
Heizungsspezialist Kadir Karahan erläutert PZ-Redakteur Walter Kindlein die aktuellen Möglichkeiten.
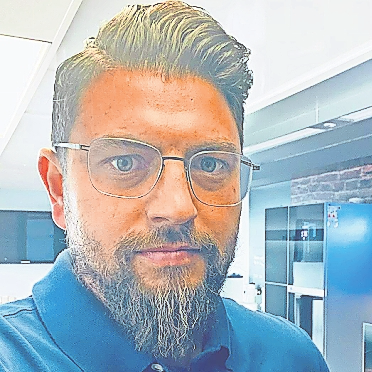
Hat sich der Druck zu handeln verändert?
Ja. Die Notwendigkeit zur Dekarbonisierung des Gebäudesektors ist dringlicher denn je – sowohl aus ökologischen als auch aus ökonomischen Gründen. Insbesondere die steigende CO₂-Bepreisung und die daraus resultierenden Betriebskosten fossiler Systeme erhöhen den Druck zum Umstieg.
Wie sieht es mit der Lieferfähigkeit der Hersteller aus?
Die Situation hat sich im Vergleich zu den letzten Jahren deutlich verbessert. Aktuell bestehen keine nennenswerten Produktengpässe mehr. Einzelne Hersteller haben jedoch Umstrukturierungen ihrer Produktionslinien angekündigt, wodurch kurzfristige Verzögerungen nicht auszuschließen sind. Eine frühzeitige Projektplanung ist daher empfehlenswert, um eine reibungslose Integration sicherzustellen.
Wie entwickeln sich denn die Preise?
Die Kosten für regenerative Heizsysteme stabilisieren sich. Während Skaleneffekte bei der Serienfertigung zu sinkenden Gerätepreisen führen können, bleiben Fachhandwerksleistungen weiterhin kostenintensiv. Wichtig ist, die Gesamtkosten inklusive Einsparpotenzial durch geringere Betriebskosten zu bewerten.
Wie entwickelt sich die Technik, etwa bei Wärmepumpen?
Technologisch schreiten Wärmepumpen stark voran. Höhere Jahresarbeitszahlen, verbesserte Kältemittel und flexible Systemlösungen ermöglichen inzwischen auch die effiziente Nutzung in unsanierten Bestandsgebäuden – sofern ein hydraulischer Abgleich und eventuell Sanierungsmaßnahmen berücksichtigt werden.
Ist eine moderne Ölheizung noch sinnvoll?
Aus technischer Sicht bietet die Ölheizung keinen zukunftsfähigen Beitrag mehr zum Klimaschutz. Die Arbeit zeigt deutlich: Nur Systeme mit regenerativer Energieerzeugung – wie Wärmepumpe, Biomasse oder solarthermische Ergänzung – erfüllen die Anforderungen an langfristige Versorgungssicherheit und Emissionsminderung.
Wie sieht es mit den Fördermöglichkeiten aus?
Die Förderung bleibt attraktiv. Bis zu 70 Prozent der Investitionskosten können im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude bezuschusst werden. Die Auswahl des Heizsystems und die korrekte Antragstellung sind dabei entscheidend – insbesondere im Hinblick auf die 65-Prozent-Regel für erneuerbare Energien.








