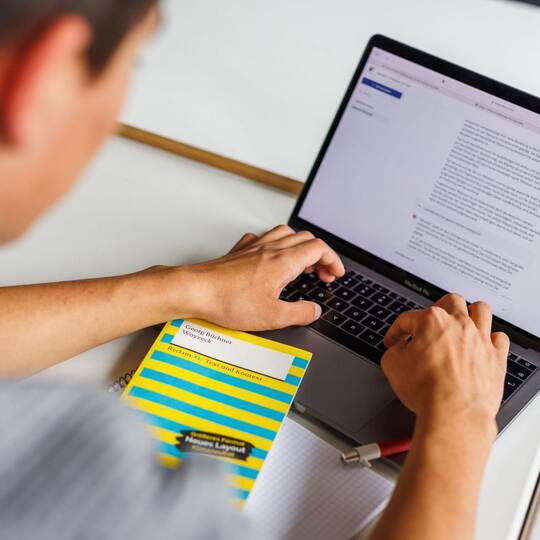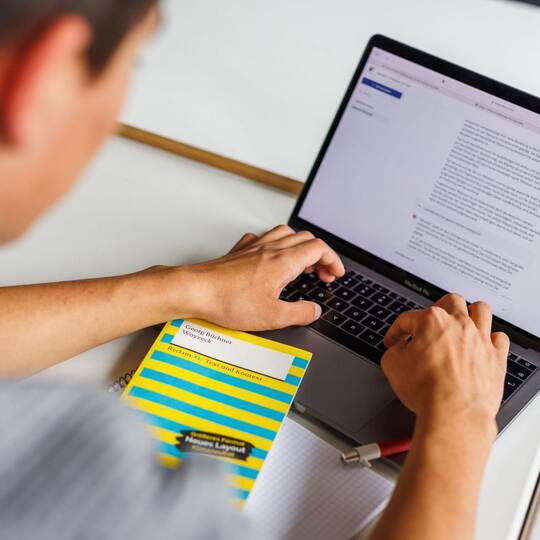Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) fordert, Schüler über mögliche Kriegsgefahren zu informieren - mit je einer Doppelstunde im Schuljahr. Ist das der richtige Weg, um mit der sicherheitspolitischen Lage umzugehen? Zwei PZ-Redakteure sind unterschiedlicher Meinung.
Pro: PZ-Redakteurin Catherina Arndt
„Das Sicherheitsgefühl der Jüngsten kann so gestärkt werden.“
Die Idee von Innenminister Alexander Dobrindt (CSU), angesichts der aktuellen sicherheitspolitischen Lage in Schulen auf mögliche Krisen vorzubereiten, ist gut. Auch die Beschränkung auf eine Doppelstunde im Jahr ergibt Sinn. Was sollte man für den Notfall an Vorräten zu Hause haben, wie handelt man bei Stromausfällen und welche Verstecke eignen sich zum Schutz vor Luftangriffen – das sind sensible Themen, die sorgfältig pädagogisch begleitet werden müssen. Das Sicherheitsgefühl der Jüngsten kann so gestärkt werden. Das Thema als festes Fach im Lehrplan zu verankern, könnte allerdings einen negativen Effekt haben. Wer jeden Tag über mögliche Katastrophen lernt, könnte schnell den Eindruck bekommen, sich ständig in Gefahr zu befinden – so würden sich Schüler letztlich noch unsicherer fühlen als jetzt schon. Zivilschutz sollte so gelehrt werden, wie Brandschutz und Erste Hilfe: Als wiederkehrender Workshop, um die wichtigsten Kenntnisse zu festigen und so ein Handeln im äußersten Notfall zu ermöglichen.
Kontra: PZ-Redakteur Dominique Jahn
„Man darf bei den Schülern keine Angst schüren.“
Krisenunterricht in der Schule – einmal im Jahr eine Doppelstunde – klingt vernünftig, schließlich leben wir in unruhigen Zeiten. Doch wer glaubt, man könne in 90 Minuten auf Krisen vorbereitet werden, unterschätzt, was Bildung leisten muss. Eine Doppelstunde bringt keinen Mehrwert und reicht bei weitem nicht aus. Viele Schulen sind ja auch schon aktiv: In Projekten üben Schüler Notfallsituationen, sprechen über Zivilschutz und greifen aktuelle Themen in diversen Fächern auf. Diese Ansätze sollten gezielt gestärkt werden – mit einem neuen Unterrichtsfach.
Ein Blick nach England zeigt, wie es gehen könnte. Dort gehören sogenannte Resilience Lessons fest zum Lehrplan. Kinder lernen hier nicht nur, was im Notfall zu tun ist, sondern auch, wie man mit Angst, Unsicherheit , Falschinformationen und gesellschaftlichen Krisen umgeht.
Wichtig beim Umsetzen des Krisenunterrichts ist es, auf alle Fälle sensibel vorzugehen. Wer in Schulen über Krisen spricht, darf keine Panik schüren. Schule sollte ein Ort der Orientierung bleiben – nicht der Angst.


„Die Leistungen werden schlechter“: Fünf Erkenntnisse aus dem Schömberger Schulalltag