Aufhalten lässt sich der technische Fortschritt nicht. Das galt damals für das Auto und es gilt heute für Künstliche Intelligenz. Und so wie die Motorwagen von Carl Benz und Gottlieb Daimler skeptisch beäugt wurden, schlägt heute KI Misstrauen entgegen. Aber ist die Sorge berechtigt?
Ein Kommentar von PZ-Redakteurin Catherina Arndt
Ja – aber nicht nur. KI-Technologien eröffnen schon heute neue Möglichkeiten: Intelligente Produktionssysteme sorgen dafür, dass Produkte effizienter hergestellt werden, sie optimieren Lieferketten und sparen Ressourcen. Für den angespannten Arbeitsmarkt verheißt das zunächst aber keine Entspannung. Gerade dort, wo KI Entlastung schafft, schrumpft der Stellenmarkt – zum Beispiel in der IT oder im Finanzwesen. Vor der Pandemie galten solche Branchen noch als sichere Karrierewege. Dann kam ChatGPT. Nun sind Zehntausende Hochschulabsolventen – klassische Bürojobber – ohne Arbeit.
Doch das müssen wir auch als Chance begreifen – etwa für das Handwerk, den Einzelhandel oder die Gastronomie, wo händeringend Personal gesucht wird. Natürlich müssen die Bedingungen stimmen. Aber Jobs in den Branchen sind sicher – zumindest so lange, bis auch dort KI-Lösungen Einzug halten. Schon jetzt gibt es humanoide Roboter. Bislang messen sich diese aber noch stolpernd in Sportwettbewerben. Aber so verschiebt und verringert sich die Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt, je mehr Bereiche KI erfasst – bis theoretisch irgendwann der Mensch keinen Job mehr selbst machen muss? Das klingt erschreckend. Ist aber auch das utopische Szenario.


Warum Jugendliche sich ChatGPT anvertrauen - und warum das gefährlich sein kann
Aber auch in den Alltag hält KI Einzug: Natürlich entlastet es, wenn einem die Technik selbst die einfachsten Entscheidungen abnimmt. Aber diese ständige Nutzung fängt schon bei den Jüngsten an: Viele Schüler lösen Aufgaben nur noch mit Hilfe von ChatGPT – Lernprozesse bleiben außen vor. Aus diesen Schülern werden im schlimmsten Fall denkfaule Erwachsene, die KI als Krücke benutzen.
Schon heute sprechen Menschen mit ihr wie mit einem Freund, nutzen sie als Therapeut. Währenddessen schwindet der soziale Zusammenhalt, die Gräben in der Gesellschaft werden immer tiefer. Das ist das dystopische Szenario. Dass die KI hier nicht die Überhand gewinnt, muss das langfristige Ziel sein.
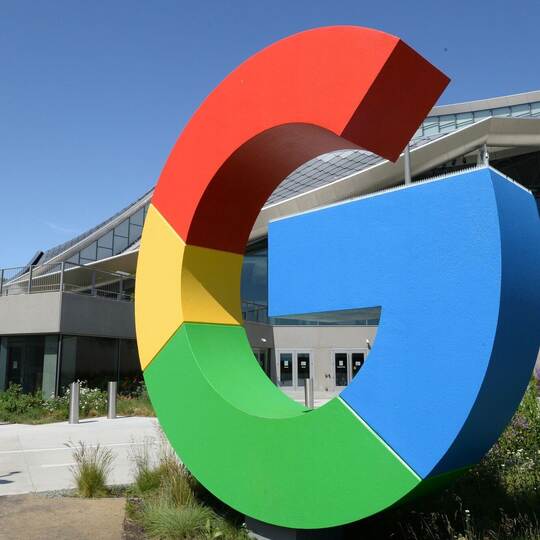
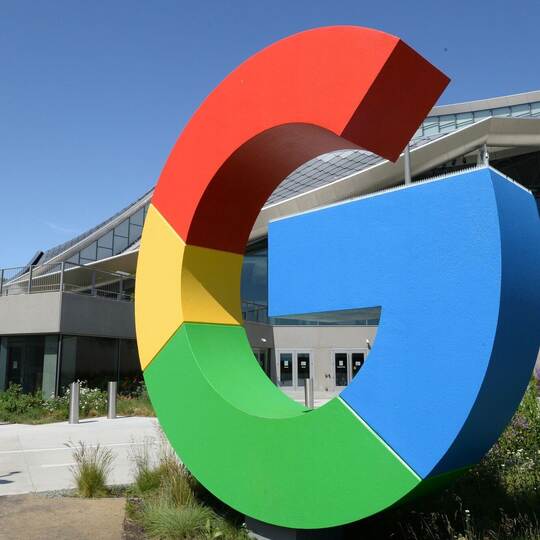
Google: KI-Anfrage braucht Strom wie neun Sekunden Fernsehen
Politik und Wirtschaft müssen sich bemühen, dafür einen Plan zu erarbeiten – mit konkreten Leitlinien, was KI darf und was nicht. Der AI-Act der EU ist ein wichtiger erster Schritt. Damit diese Regeln auch Anwendung finden, braucht es aber den politischen Willen und vor allem den Mut, diese Regeln gegenüber den großen Tech-Konzernen durchzusetzen. Damit die KI dem Menschen nicht irgendwann das Menschsein nimmt.

